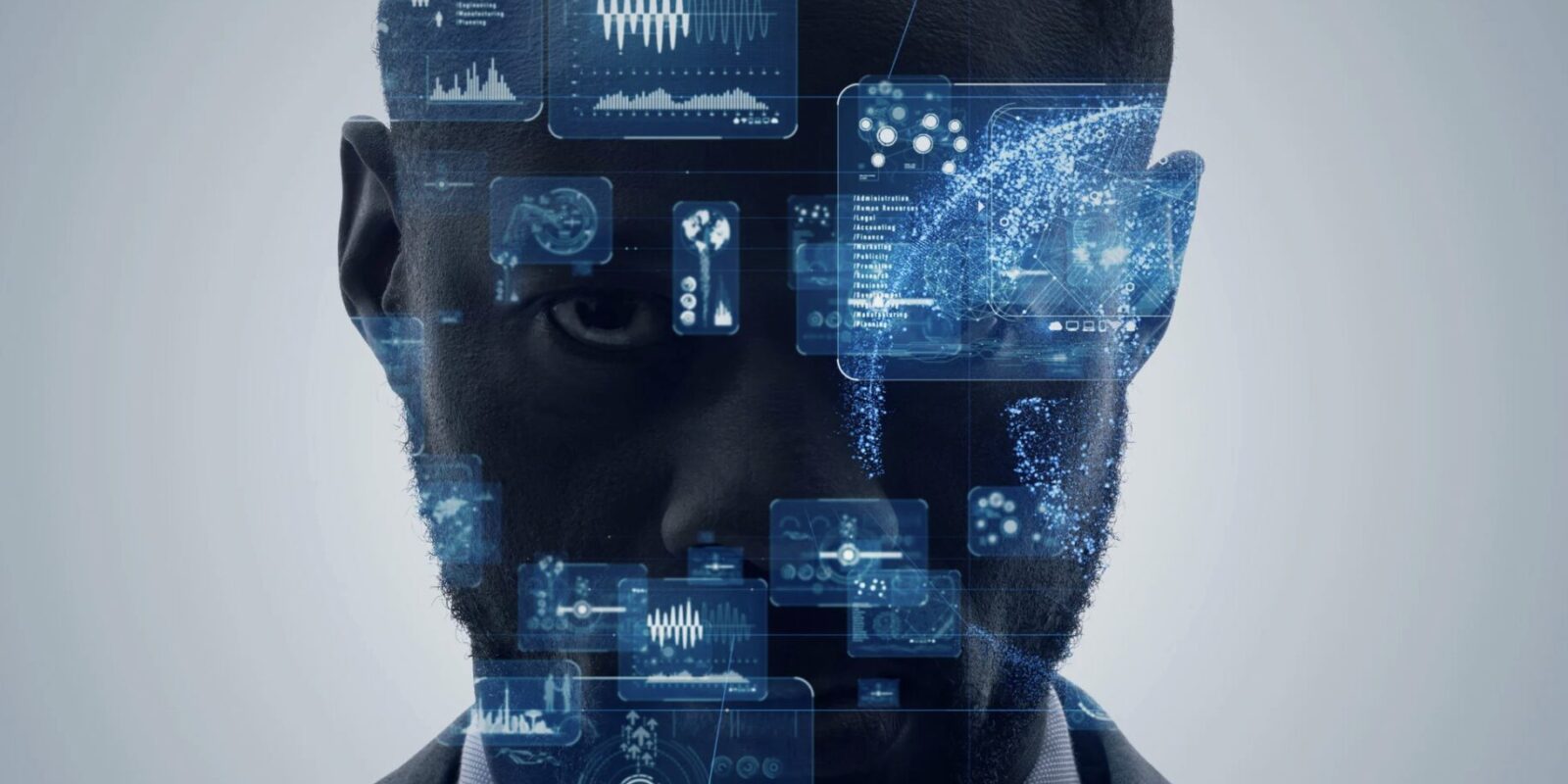In den vergangenen Monaten hat die Euphorie rund um die Künstliche Intelligenz (KI) weltweit zugenommen. Viele Unternehmen versprechen sich enorme Produktivitätsgewinne, während Analysten darüber diskutieren, wie die möglichen Folgen für Wachstum, Inflation und Beschäftigung aussehen könnten. Klar ist: KI ist längst mehr als ein Trend, der in absehbarer Zeit wieder von der Bildschirmfläche verschwinden wird. Sie verändert Strukturen, Märkte und Arbeitsprozesse mit Chancen, aber auch mit einigen nicht zu unterschätzenden Risiken.
KI treibt Börsen und Unternehmen auf neue Höhen
Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie groß der Einfluss von KI auf die Finanzmärkte bereits ist: Der Aktienkurs eines großen Chipherstellers ist zuletzt um rund 40 Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen eine milliardenschwere Kooperation mit einem führenden KI-Entwickler angekündigt hat. Solche Nachrichten bewegen die Börsen und sie unterstreichen, wie stark die Technologie inzwischen die Bewertung großer Konzerne beeinflusst.
Der S&P 500, das wichtigste Börsenbarometer der USA, erreichte in den letzten Jahren immer neue Rekorde. Auch deshalb, weil „Mega Caps“ Kursgewinne verzeichnet haben. Das sind die großen Technologieunternehmen. Der KI-Boom treibt sie an, weil die Investoren davon ausgehen, dass die Technologie langfristig neue Geschäftsmodelle ermöglichen wird und in weiterer Folge enorme Kostenvorteile entstehen.
Dennoch stellt sich die berechtigte Frage, ob es sich bei dieser Entwicklung um nachhaltiges Wachstum oder um eine klassische Blase handelt. Könnte der Markt irgendwann überhitzen, wie das etwa bei der Dotcom-Blase war, oder befindet sich die Menschheit am Beginn einer industriellen Revolution? Die Antwort bleibt offen. Sicher ist nur: Die KI ist gekommen, um zu bleiben – daran gibt es keinen Zweifel. Und sie beginnt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spürbar zu verändern.
Die Produktivität steigt und die Arbeitsmärkte beginnen sich zu verändern
Ein Blick auf die jüngsten Wirtschaftsdaten zeigt ein interessantes Bild: Obwohl nur wenige neue Arbeitsplätze entstanden sind, ist die US Wirtschaft solide gewachsen. Laut dem Bureau of Labor Statistics wurden zwischen April 2024 und März 2025 fast eine Million weniger Stellen geschaffen als zuvor angenommen und dennoch blieb die Wirtschaftsleistung stark. Das heißt, dass Produktivitätsgewinne derzeit der wichtigste Wachstumstreiber sind.
Das legt nahe, dass Unternehmen zunehmend mit Technologien arbeiten, die dabei helfen, dass mit weniger Personal mehr Output erzielt wird. Dass da die KI im Mittelpunkt steht, dürfte nicht überraschend sein. Durch den Einsatz automatisierter Systeme können Firmen Prozesse beschleunigen, Kosten senken und ihre Gewinnmargen sichern.
Studien gehen davon aus, dass die KI die Produktivität in den USA bis zum Jahr 2035 um etwa 1,5 Prozent und bis 2055 um fast 3 Prozent erhöhen könnte. Auch für die G7 Staaten rechnen Experten in den kommenden zehn Jahren mit jährlichen Zuwächsen zwischen 0,2 Prozent und 1,3 Prozent. Wie stark der Effekt wirklich sein wird, hängt aber auch davon ab, wie schnell Unternehmen die Technologie implementieren und in welchen Branchen sie eingesetzt werden.
Auf operativer Ebene können die Veränderungen bereits gemessen werden: Etwa 80 Prozent der US Beschäftigten erledigen inzwischen mindestens 10 Prozent ihrer Arbeit mithilfe großer Sprachmodelle. Ein Fünftel von ihnen kann sogar die Hälfte ihrer Arbeit durch die KI erledigen lassen. Besonders Technologieunternehmen profitieren davon: Nachdem ChatGPT Ende 2022 auf den Markt gekommen ist, sind die Umsätze je Mitarbeiter um 38 Prozent gestiegen, was ein deutliches Signal für steigende Effizienz ist.
Chancen und Risiken des technologischen Wandels
Die Effizienzgewinne sind absolut beeindruckend, aber sie kommen nicht allen gleichermaßen zugute. Während die USA und China aufgrund hoher Investitionen und flexibler Regulierung als Vorreiter gelten, droht Europa hingegen den Anschluss zu verlieren. Strengere Datenschutz- und Haftungsregeln bremsen den großflächigen Einsatz von KI, was sich langfristig auf Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität auswirken wird. Ein gutes Beispiel, wie man sich verläuft, mag Deutschland sein. Hier mit Blick auf den deutschen Glücksspielstaatsvertrag. Während weltweit Live Spiele im Online Casino zur beliebtesten Sparte gehören, ist diese Kategorie laut deutschem Recht verboten. Somit ist es nicht überraschend, dass viele deutsche Glücksspielfans Ausschau nach Anbietern ohne deutsche Lizenz halten. Alle Casinos ohne OASIS im Test punkten nämlich mit Live Casino und weiteren Vorteilen. Denn ohne deutsche Lizenz gibt es auch keine Maximaleinzahlungsbegrenzung von 1.000 Euro pro Monat und keine 5 Sekunden-Regel, zudem gibt es auch keinen Maximaleinsatz von 1 Euro bei Slots.
Zudem ist natürlich klar, dass das aktuelle Investitionstempo nicht ewig anhalten wird. Derzeit fließt ein erheblicher Teil der Unternehmensgewinne in Rechenzentren, Datenverarbeitung und KI-Software. Doch nachdem sich die Technologie etabliert hat, dürfte das Wachstum dieser Ausgaben geringer ausfallen. Das wird auch an den Börsen spürbar sein: Manche Firmen werden weiter profitieren, andere könnten hingegen den Anschluss verlieren.
Diese sogenannte „kreative Zerstörung“ ist natürlich Teil jedes technologischen Umbruchs. Während einige Branchen aufblühen, werden andere verdrängt oder völlig neu aufgestellt. Besonders betroffen ist der Arbeitsmarkt: Viele klassische Bürojobs, beispielsweise in der Verwaltung, Datenanalyse oder im Kundendienst, könnten auf lange Sicht entfallen oder sich grundlegend verändern.
Politisch stellt das die Regierungen vor neue Aufgaben. Sie müssen nämlich Wege finden, Qualifizierung und Umschulung zu fördern, damit Arbeitskräfte in neuen Tätigkeitsfeldern untergebracht werden können. Gleichzeitig wächst der Druck, soziale Sicherungssysteme an eine zunehmend automatisierte Wirtschaft anzupassen.
Langfristige Auswirkungen auf Märkte und Geldpolitik
Auch für Investoren wird die Entwicklung der KI zu einem zentralen Faktor werden. Die entscheidende Frage lautet nämlich, wie schnell übersetzen sich Produktivitätsfortschritte in höhere Gewinne, stabile Löhne und neue Wachstumschancen?
Tatsächlich ist es noch zu früh, um endgültige Schlüsse zu ziehen. Aber das Zusammenspiel aus solidem Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig schwachem Beschäftigungsaufbau deutet darauf hin, dass die Produktivität in vielen Bereichen deutlich stärker steigt als man anfangs erwartet hat.
Für Anleger ergibt sich daraus ein positives Bild: Wenn Produktivitätssteigerungen das Wirtschaftswachstum ankurbeln, ohne dass dadurch die Inflation erhöht wird, können Zentralbanken wie die US Notenbank (Fed) eine lockere Geldpolitik beibehalten. Das unterstützt risikoreichere Anlageklassen. Vor allem Aktien von Unternehmen, die KI gezielt einsetzen, um ihre Margen zu verbessern.